|
|
| Abschnitt I: Allgemeine Bestimmungen | |
| § 1 | Geltungsbereich |
| § 2 | Qualifikationsziele, Prüfungszweck und Abschlüsse |
| § 3 | Studien- und Prüfungsaufbau, Module und Leistungspunkte |
| § 4 | Lehrveranstaltungsarten |
| Abschnitt II: Prüfungsformen | |
| § 5 | Schriftliche Prüfungen |
| § 6 | Durchführung von Prüfungen im Antwort-Wahl-Verfahren |
| § 7 | Durchführung von Prüfungen als „E-Klausur“ |
| § 8 | Mündliche Prüfungen |
| § 9 | Masterarbeit |
| § 10 | Kolloquium zur Masterarbeit |
| Abschnitt III: Durchführung von Prüfungen | |
| § 11 | Vorschlagsrecht, Anzahl an Prüfenden, Öffentlichkeit von Prüfungen |
| § 12 | Zulassungsvoraussetzungen zu Prüfungen, Anmeldung zu und Abmeldung von Prüfungen |
| § 13 | Nachteilsausgleich |
| § 14 | Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, Erziehungsurlaub |
| § 15 | Bewertung der Prüfungen, Bildung und Gewichtung von Noten |
| § 16 | Versäumnis und Rücktritt |
| § 17 | Täuschung und Ordnungsverstoß |
| § 18 | Bestehen und Nichtbestehen |
| § 19 | Wiederholung von Prüfungen |
| § 20 | Fristen für die Wiederholung von Prüfungen |
| § 21 | Anerkennung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen |
| § 22 | Ungültigkeit von Prüfungen |
| § 23 | Bescheide, Rechtsmittel, Widerspruch, Einsicht in die Prüfungsakten |
| § 24 | Zeugnis der Masterprüfung und Masterurkunde |
| § 25 | Zertifikate |
| § 26 | Weitere Bescheinigungen |
| Abschnitt IV: Prüfende und Prüfungsorgane | |
| § 27 | Prüfungsausschuss |
| § 28 | Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer |
| Abschnitt V: Schlussbestimmungen | |
| § 29 | Übergangsregelung und Inkrafttreten |
| Anlagen |
Der Allgemeine Teil für Prüfungsordnungen im Weiterbildungsbereich (AT PO-WB) gilt nach Maßgabe von § 29 für alle Weiterbildungsangebote der Universität Bremen. In den angebotsspezifischen Prüfungsordnungen werden Regelungen zu Aufbau und Inhalt des Studiums auf Grundlage dieser Ordnung getroffen.
(1) Das Angebot der Universität Bremen in der Weiterbildung unterscheidet die Formate „Weiterbildendes Studium mit Masterabschluss“, „Weiterbildendes Studium mit Zertifikatsabschluss“, „Weiterbildungskurs mit Zertifikatsabschluss“ und „Modulstudium“ sowie sonstige weiterbildende Veranstaltungen (Ein- und Mehrtagesseminare).
(2) Ein „Weiterbildendes Studium mit Masterabschluss“ ist ein Studienangebot für Personen, die in der Regel nach einem ersten Studienabschluss und einer Phase einer Berufstätigkeit weitergehende wissenschaftliche Kompetenzen erwerben und dies mit dem Mastertitel dokumentieren wollen. Ein „Weiterbildendes Studium mit Masterabschluss“ umfasst 60 bis 120 CP. Nach der bestandenen Masterprüfung und nach einem Gesamtstudienumfang von 300 CP wird der akademische Grad Master of Arts (M. A.), Master of Science (M. Sc.), Master of Engineering (M. Eng.) oder Master of Law (LL. M.) vergeben. Die Vergabe des Grades richtet sich nach § 24 Absatz 6. Der Masterabschluss wird nach bestandener Masterprüfung, die aus studienbegleitenden Prüfungsleistungen, der Masterarbeit und ggf. einem Kolloquium besteht, verliehen.
(3) Ein „Weiterbildendes Studium mit Zertifikatsabschluss“ setzt einen kontinuierlichen akademischen Lernprozess mit einem Workload von mind. 22 CP voraus. Es besteht aus Modulen. Ein „Weiterbildendes Studium mit Zertifikatsabschluss“ wird mit einem Zertifikat testiert, das auch die Leistungspunkte ausweist. Es muss mindestens eine Leistungskontrolle pro Modul vorsehen. Es kann zusätzlich eine Abschlussprüfung vorsehen.
(4) Ein „Weiterbildungskurs mit Zertifikatsabschluss“ beinhaltet Lernleistungen mit einem Workload von mindestens 12 CP und maximal 21 CP. Er wird mit einem Zertifikat testiert, das auch die Leistungspunkte ausweist. Er muss mindestens eine Leistungskontrolle pro Modul enthalten.
(5) Einzelne Module aus bestehenden grundständigen oder weiterbildenden Studienangeboten können nach Maßgabe der freien Plätze und der Eignung der Bewerberin/des Bewerbers in freier Wahl als Weiterbildung studiert werden („Modulstudium“). Über die Eignung und Zulassung entscheiden die Akademie für Weiterbildung und die/der Modulverantwortliche gemeinsam. Pro Studienjahr können auf diese Weise maximal 10 CP erworben werden.
(6) Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung werden von einem oder mehreren Fachbereichen der Universität Bremen inhaltlich verantwortet, entwickelt und durchgeführt. Dies soll in Kooperation mit der Akademie für Weiterbildung geschehen. Externe Partner können beteiligt werden.
(7) Die Formate lt. Absatz 1 bis 4 zeichnen sich dadurch aus, dass Beruf und Studium nebeneinander bzw. im optimalen Fall miteinander verzahnt stattfinden. Die Veranstaltungen werden daher i. d. R. gesondert angeboten und sind für Studierende in der Erstausbildung nicht geöffnet. Aus diesem Sachverhalt ergibt sich u. a. die Entgeltpflicht.
(1) Weiterbildungsangebote gemäß § 2 Absatz 2, 3 und 4 sind in Module gegliedert. Ein Modul ist die Zusammenfassung von Stoffgebieten zu thematisch und zeitlich abgerundeten, in sich abgeschlossenen und mit Leistungspunkten versehenen abprüfbaren Einheiten.
(2) Die angebotsspezifische Prüfungsordnung regelt Anzahl, Titel (Modulbezeichnung), Leistungspunktumfang der Module, Modulvoraussetzungen und Prüfungsanforderungen. Sie weist einen Musterstudienplan, der eine Empfehlung für einen Studienverlauf darstellt, aus. Grundsätzlich gilt dabei, dass für Prüfungsinhalte, -fristen, -arten, -verfahren etc. die Prüfungsordnung desjenigen Fachs gilt, welches das Modul bzw. die Veranstaltung und die Prüfung anbietet. Das „Modulstudium“ bedarf keines Prüfungsausschusses.
(3) Module können sein: Pflichtmodule, Wahlpflichtmodule und Wahlmodule. Ein Pflichtmodul ist von allen Studierenden zu belegen, die dazugehörige Prüfung muss bestanden sein. Bei einem Wahlpflichtmodul können die Studierenden aus einem vorgegebenen Katalog im Umfang von in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung festgelegten Leistungspunkten auswählen und müssen dann das Wahlpflichtmodul mit der dazugehörigen Modulprüfung bestehen. Bei einem Wahlmodul können die Studierenden innerhalb eines in der jeweiligen angebotsspezifischen Prüfungsordnung zu definierenden Bereichs und Leistungspunktumfangs auswählen. Bei Nichtbestehen kann das Wahlmodul gemäß § 19 Absatz 3 durch ein anderes Modul ersetzt werden.
(4) Die angebotsspezifische Prüfungsordnung kann vorsehen, dass im Wahlmodulbereich bis zu zwei Module mehr, als zum Erreichen des erforderlichen Umfangs an Leistungspunkten notwendig ist, erbracht werden können. Vor Beginn des letzten Studienabschnitts ist von der Kandidatin/dem Kandidaten anzugeben, welche Wahlmodule in die Masterprüfung bzw. in das Zertifikat einfließen sollen.
(5) Ein Modul soll so konzipiert werden, dass es im Regelfall innerhalb von 12 Monaten absolviert werden kann.
(6) Im „Weiterbildenden Studium mit Masterabschluss“ ist der Umfang der Masterarbeit mit 15 bis 30 Leistungspunkten in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung festzulegen. Sofern ein Kolloquium vorgesehen ist, sind Leistungspunkte für das Kolloquium dabei mit eingeschlossen.
(7) Jedem Modul werden Leistungspunkte (Credit Points = CP) entsprechend dem European Credit Transfer System zugeordnet. Leistungspunkte sind ein quantitatives Maß für die Gesamtarbeitsbelastung der Studierenden. Ein Leistungspunkt entspricht einer Arbeitszeit von 30 Stunden.
(8) Leistungspunkte können nicht für eine bloße Teilnahme an Modulen vergeben werden, sondern ihre Vergabe setzt den Nachweis einer erfolgreich abgelegten Modulprüfung voraus.
(9) Jedes Modul wird mit einer studienbegleitenden Modulprüfung abgeschlossen. Eine Modulprüfung kann aus einer Prüfungs- oder einer Studienleistung bestehen oder aus einer Kombinationsprüfung, die aus mehreren Prüfungs- und Studienleistungen, die auch miteinander kombiniert werden können, besteht. Näheres, insbesondere Anzahl, Art und Umfang dieser Nachweise sowie deren Gewichtung bei der Ermittlung der Modulnote werden in der Modulbeschreibung festgelegt, die den Studierenden vor Veranstaltungsbeginn in geeigneter Weise bekannt zu geben ist. In der Regel muss jede Prüfungsleistung innerhalb einer Kombinationsprüfung bestanden sein. Die angebotsspezifische Prüfungsordnung kann ein Kompensationsprinzip vorsehen. Die Modulprüfung kann auch aus Teilprüfungen bestehen, die in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung ausgewiesen werden.
(10) Eine Prüfungsleistung wird benotet. Eine Studienleistung wird mit „bestanden“ oder mit „nicht bestanden“ bewertet, sie kann benotet werden. Die Note dient der Information der Studierenden über ihren Leistungsstand und wird bei der Festlegung der Modulnote oder Gesamtnote nicht berücksichtigt.
(11) Prüfungs- und Studienleistungen dürfen in einem Modul in der Regel nicht Zulassungsvoraussetzung für eine andere im Modul abzulegende Prüfungsleistung sein.
(12) Eine Modulprüfung ist studienbegleitend, wenn sie innerhalb von 60 Tagen, nachdem das Modul endete, erstmalig angeboten wird.
(13) Im Modulhandbuch sind universitätseinheitlich für jedes Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodul die gemäß den Strukturvorgaben der Kultusministerkonferenz erforderlichen Beschreibungen festzuhalten.
(1) Ziele und Inhalte des jeweiligen weiterbildenden Angebots werden durch die in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung vorgesehenen Lehrveranstaltungen mit deren Lehrformen vermittelt. Es können insbesondere folgende Lehrveranstaltungen festgelegt werden:
Vorlesungen, Übungen, Seminare,
Sprachlehrveranstaltungen, Projektstudien/Projektseminare,
Praktika,
Begleitseminar zur Masterarbeit, Betreute Selbststudieneinheiten, Exkursionen.
In der angebotsspezifischen Prüfungsordnung können weitere Lehrveranstaltungsarten oder Kombinationen von Lehrveranstaltungsarten vorgesehen werden.
(2) Alle Lehrveranstaltungen finden innerhalb von Modulen statt. Wahlpflicht- oder Wahlveranstaltungen, bei denen bereits im Rahmen von Modulen, die für den Zugang zum Weiterbildungsangebot anerkannt wurden, Prüfungen abgelegt worden sind, können im Masterstudiengang nicht mehr gewählt werden.
(1) Schriftliche Prüfungen sind Klausuren oder sonstige schriftliche Leistungen. Als sonstige schriftliche Leistungen gelten Projektarbeiten, Hausarbeiten, Praktikumsberichte.
(2) Die angebotsspezifische Prüfungsordnung kann weitere Prüfungsformen vorsehen. Der Prüfungsausschuss kann im Einzelfall auf Antrag einer Prüferin/eines Prüfers weitere Prüfungsformen zulassen. Die angebotsspezifische Prüfungsordnung kann den Studierenden für die einzelnen Prüfungen verschiedene Prüfungsformen zur Wahl stellen. Die Wahlmöglichkeiten können von der Veranstalterin/dem Veranstalter eingegrenzt werden.
(3) Prüfungen können in geeigneten Fällen nach Maßgabe der Prüferin/des Prüfers auch durch eine Gruppe von Studierenden in Zusammenarbeit angefertigt werden (Gruppenarbeit), wenn der Beitrag jedes einzelnen Gruppenmitglieds klar erkennbar, abgrenzbar und bewertbar ist.
(4) Eine Klausur ist eine unter Aufsicht anzufertigende Arbeit, in der vorgegebene Aufgaben allein und selbstständig nur mit den zugelassenen Hilfsmitteln zu bearbeiten sind. Die Dauer einer Klausur beträgt mindestens 45 und höchstens 180 Minuten. Die angebotsspezifische Prüfungsordnung kann eine andere Regelung vorsehen. Klausuren können auch in Form von Antwort-Wahl-Verfahren durchgeführt werden. In diesem Fall sind in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung Regelungen über die Tätigkeit von Prüfungsausschuss und Prüfenden bei der Aufgabenerstellung sowie über die Bestehensvoraussetzungen und Notenvergabe zu treffen. Eine schriftliche Prüfung kann auch in elektronischer Form abgenommen werden. Den Studierenden wird vor der Prüfung ausreichend Gelegenheit gegeben, sich mit dem elektronischen Prüfungssystem vertraut zu machen. Datenschutzrechtliche Bestimmungen sind einzuhalten.
(5) Eine Hausarbeit ist eine eigenständige schriftliche Ausarbeitung eines vorgegebenen Themas, das im Rahmen des betreffenden Moduls behandelt wurde.
(6) In Projektarbeiten wird die Fähigkeit zur Entwicklung, Durchführung und Präsentation von größeren Arbeiten im Team gelernt.
(7) Ein Praktikumsbericht ist eine schriftliche Darstellung und Analyse der in einem inner- oder außeruniversitären Praktikum behandelten Aufgaben.
(8) Ein Portfolio ist eine Sammlung von mehreren bearbeiteten Aufgaben im weitesten Sinne, die zusammenfassend bewertet wird.
(9) Bei der Abgabe einer schriftlichen Arbeit, die nicht unter Aufsicht erarbeitet wurde, hat die/der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie/er die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit die von ihr/ihm zu verantwortenden, entsprechend gekennzeichneten Teile - selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen sind unter Angabe der Quellen kenntlich zu machen. Dies gilt auch für Internetquellen.
(1) Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren liegt vor, wenn die für das Bestehen der Prüfung mindestens erforderliche Leistung der Prüfungskandidatinnen und Prüfungskandidaten ausschließlich durch Markieren oder Zuordnen der richtigen oder der falschen Antworten erreicht werden kann. Prüfungen bzw. Prüfungsfragen im Antwort-Wahl-Verfahren sind nur zulässig, wenn sie dazu geeignet sind, den Nachweis zu erbringen, dass die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden kann. Eine Prüfung im Antwort-Wahl-Verfahren ist von einer Prüferin/einem Prüfer gemäß § 27 vorzubereiten. Die Prüferin/Der Prüfer wählt den Prüfungsstoff aus, formuliert die Fragen und legt die Antwortmöglichkeiten fest. Ferner erstellt sie/er das Bewertungsschema gemäß Absatz 4 und wendet es im Anschluss an die Prüfung an. Der Abzug von Punkten innerhalb einer Prüfungsaufgabe im Mehrfach-Antwort-Wahl-Verfahren ist zulässig.
(2) Die Prüfungsfragen müssen zweifelsfrei verstehbar, eindeutig beantwortbar und dazu geeignet sein, die gemäß Absatz 1 Satz 2 zu überprüfenden Kenntnisse der Kandidatinnen und Kandidaten festzustellen. Die Prüferin/Der Prüfer kann auch einen Pool von gleichwertigen Prüfungsfragen erstellen. In der Prüfung erhalten Studierende aus diesem Pool jeweils unterschiedliche Prüfungsfragen zur Beantwortung. Die Zuordnung geschieht durch Zufallsauswahl. Die Gleichwertigkeit der Prüfungsfragen muss sichergestellt sein. Die Voraussetzungen für das Bestehen der Prüfung sind vorab festzulegen. Ferner sind für jede Prüfung
die ausgewählten Fragen,
die Musterlösung und
das Bewertungsschema gemäß Absatz 4 festzulegen.
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn die Kandidatin/der Kandidat mindestens 50 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte erzielt hat. Liegt der Gesamtdurchschnitt der in einer Prüfung erreichten Punkte unter 50 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte, so ist die Klausur auch bestanden, wenn die Zahl der von der Kandidatin/dem Kandidaten erreichten Punkte die durchschnittliche Prüfungsleistung aller Prüfungsteilnehmer um nicht mehr als 15 Prozent unterschreitet. Ein Bewertungsschema, das ausschließlich eine absolute Bestehensgrenze festlegt, ist unzulässig.
(4) Die Leistungen sind wie folgt zu bewerten: Wurde die für das Bestehen der Prüfung gemäß Absatz 3 erforderliche Mindestzahl der erreichbaren Punkte erzielt, so lautet die Note
| „sehr gut“, | wenn mindestens 75 Prozent, |
| „gut“, | wenn mindestens 50 aber weniger als 75 Prozent, |
| „befriedigend“, | wenn mindestens 25 aber weniger als 50 Prozent, |
| „ausreichend“, |
wenn keine oder weniger als 25 Prozent der |
darüber hinaus erreichbaren Punkte erzielt wurden.
(5) Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungsleistungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren abgelegt worden sind, eine auffällige Fehlerhäufung bei der Beantwortung einzelner Prüfungsaufgaben, so überprüft die Prüferin oder der Prüfer die Prüfungsaufgabe mit auffälliger Fehlerhäufigkeit unverzüglich und vor der Bekanntgabe von Prüfungsergebnissen darauf, ob sie gemessen an den Anforderungen gemäß Absatz 2 Satz 1 fehlerhaft sind. Ergibt die Überprüfung, dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind diese Prüfungsaufgaben nachzubewerten oder bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses nicht zu berücksichtigen. Die Zahl der für die Ermittlung des Prüfungsergebnisses zu berücksichtigenden Prüfungsaufgaben mindert sich entsprechend. Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil der Studierenden auswirken. Übersteigt die Zahl der auf die zu eliminierenden Prüfungsaufgaben entfallenden Punkte 20 Prozent der insgesamt erreichbaren Punkte, so ist die Prüfung insgesamt zu wiederholen; dies gilt auch für eine Prüfungsleistung, in deren Rahmen nur ein Teil im Antwort-Wahl-Verfahren zu erbringen ist.
(6) Besteht nur ein Teil einer Klausur aus Prüfungsaufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren, so gilt § 6 mit Ausnahme von Absatz 5 Satz 5, 2. Halbsatz nur für den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten Klausurteil.
(1) Eine „E-Klausur“ ist eine Prüfung, deren Erstellung, Durchführung und Auswertung (mit Ausnahme der offenen Fragen) computergestützt erfolgt. Eine „E- Klausur“ ist zulässig, sofern sie dazu geeignet ist nachzuweisen, dass die Prüfungskandidatin/der Prüfungskandidat die Inhalte und Methoden des Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten anwenden kann; erforderlichenfalls kann sie durch andere Prüfungsformen ergänzt werden.
(2) Die „E-Klausur“ ist in Anwesenheit einer fachlich sachkundigen Person (Protokollführerin/Protokollführer) durchzuführen. Über den Prüfungsverlauf ist eine Niederschrift anzufertigen, in die mindestens die Namen der Protokollführerin/des Protokollführers sowie der Prüfungskandidatinnen und -kandidaten, Beginn und Ende der Prüfung sowie eventuelle besondere Vorkommnisse aufzunehmen sind. Den Kandidatinnen und Kandidaten wird vor der Prüfung ausreichend Gelegenheit gegeben, sich mit dem elektronischen Prüfungssystem vertraut zu machen. Es muss sichergestellt werden, dass die elektronischen Daten eindeutig und dauerhaft den Kandidatinnen und Kandidaten zugeordnet werden können. Den Kandidatinnen und Kandidaten ist die Möglichkeit der Einsichtnahme in die computergestützte Prüfung sowie in das von ihnen erzielte Ergebnis zu gewähren. Die Aufgabenstellung einschließlich der Musterlösung, das Bewertungsschema, die einzelnen Prüfungsergebnisse sowie die Niederschrift sind gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu archivieren.
(1) Eine mündliche Prüfung ist ein Prüfungsgespräch, in dem Studierende darlegen sollen, dass sie den Prüfungsstoff beherrschen. Mündliche Prüfungen sind hochschulöffentlich, wenn die Kandidatin/der Kandidat nicht widerspricht. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf die Beschlussfassung und Bekanntgabe der Note. Studierende, die sich im gleichen Prüfungszeitraum zu dieser Prüfung gemeldet haben, sind als Hochschulöffentlichkeit nicht zugelassen. Die Kandidatin/Der Kandidat kann in jedem Fall eine Person ihres/seines Vertrauens, die Mitglied der Universität ist, zu einer mündlichen Prüfung und zur Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses hinzuziehen.
(2) Mündliche Prüfungen werden als Einzel- oder als Gruppenprüfung durchgeführt. Die Prüfungsdauer soll je Prüfling mindestens 15 und maximal 45 Minuten betragen. Die angebots-spezifische Prüfungsordnung kann eine abweichende Regelung vorsehen. Die Veranstalterin/Der Veranstalter kann in mündlichen Prüfungen den Studierenden ermöglichen, Prüfungsgegenstände vorzuschlagen. Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündlichen Prüfung sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Protokoll wird von der/dem Prüfenden und der/dem Beisitzenden unterzeichnet.
(3) Ein Referat ist der mündliche Vortrag über ein vorgegebenes Thema. Es kann zusätzlich eine schriftliche Ausarbeitung des Vortragsthemas vorgesehen werden.
(4) Als sonstige mündliche Prüfungen gelten z. B. Präsentationen oder Fachbeiträge und das Kolloquium. § 5 Absatz 2 und 3 gelten entsprechend. Die Dauer des Kolloquiums wird abweichend in § 10 Absatz 2 geregelt.
(1) Die Masterarbeit ist Bestandteil der Masterprüfung. Die Masterarbeit kann in ein Modul eingebettet sein, das zusätzlich eine oder mehrere begleitende Lehrveranstaltungen umfasst.
(2) Mit der Masterarbeit soll der Nachweis erbracht werden, dass die Kandidatin/der Kandidat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem jeweiligen Fach selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Das Thema muss so beschaffen sein, dass es innerhalb der vorgegebenen Frist bearbeitet werden kann.
(3) Die Masterarbeit kann bei geeigneter Themenstellung auch als Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag individuell zuzuordnen ist. Die individuelle Zuordnung soll aufgrund von objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, beispielsweise durch die Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder inhaltlichen Schwerpunkten erfolgen. Der insgesamt erforderliche Arbeitsaufwand für eine Gruppenarbeit muss über die Anforderungen an eine Einzelaufgabe angemessen hinausgehen; die Arbeit der Einzelnen muss den Anforderungen an eine Masterarbeit genügen.
(4) Die Kandidatin/Der Kandidat kann mit dem Antrag auf Zulassung Themen und Betreuerin/Betreuer vorschlagen. Die schriftliche Zustimmung der vorgeschlagenen Betreuerin/des vorgeschlagenen Betreuers muss vorliegen. Wird die Arbeit als Gruppenarbeit beantragt, kann die Gruppe Themen und Betreuerin/Betreuer vorschlagen. Dem Vorschlag für die Betreuerin/den Betreuer ist soweit wie möglich und vertretbar zu entsprechen. Auf Antrag vermittelt der Prüfungsausschuss eine Betreuerin/einen Betreuer.
(5) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit enthält, sofern die angebotsspezifische Prüfungsordnung dies ermöglicht, die Angabe, ob die Arbeit als Einzel- oder als Gruppenarbeit durchgeführt werden soll; ggf. sind die Gruppenmitglieder zu benennen.
(6) Die Ausgabe des Themas erfolgt durch den zuständigen Prüfungsausschuss. Der Zeitpunkt der Ausgabe und das Thema werden aktenkundig gemacht. Mit der Ausgabe des Themas bestellt der Prüfungsausschuss die Betreuerin/den Betreuer als Prüferin/Prüfer. Die weitere Prüferin/der weitere Prüfer wird spätestens mit Abgabe der Arbeit bestellt.
(7) Das Thema einer Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen zurückgegeben werden. Das Thema kann vom Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag der Kandidatin/des Kandidaten zurückgenommen werden, wenn aus fachlichen Gründen eine Bearbeitung nicht möglich ist. Das neue Thema ist unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von acht Wochen, vom Prüfungsausschuss auszugeben. Bei der Wiederholung der Masterarbeit gilt Satz 1.
(8) Die Masterarbeit wird in der Regel in deutscher oder englischer Sprache abgefasst. Die angebotsspezifische Prüfungsordnung kann eine abweichende Regelung dazu vorsehen. Die Entscheidung, ob andere als die in Satz 1 genannten Sprachen zugelassen werden, trifft der Prüfungsausschuss.
(9) Die angebotsspezifische Prüfungsordnung regelt die Bearbeitungszeit der Masterarbeit unter Berücksichtigung des Umfangs an Leistungspunkten, die der Masterarbeit zugeordnet wurden. Der Prüfungsausschuss kann bei begründetem und vor Ablauf der Bearbeitungsfrist gestelltem Antrag eine einmalige Verlängerung der Bearbeitungszeit genehmigen. Die angebotsspezifische Prüfungsordnung regelt die höchstmögliche Verlängerungsfrist, sie darf ein Drittel der Bearbeitungszeit nicht überschreiten. In Fällen außergewöhnlicher Härte kann der Prüfungsausschuss im Einzelfall eine längere Frist gewähren.
(10) Die Masterarbeit ist fristgerecht in dreifacher schriftlicher Ausfertigung sowie auch auf einem geeigneten elektronischen Speichermedium bei der Akademie für Weiterbildung einzureichen. Bei der postalischen Zusendung an die Prüfungsstelle gilt das Datum des Eingangs in der Akademie für Weiterbildung als Abgabedatum. Der Abgabezeitpunkt wird aktenkundig gemacht.
(11) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die Kandidatin/der Kandidat schriftlich zu versichern, dass sie/er die Arbeit - bei einer Gruppenarbeit die von ihr/ihm zu verantwortenden, entsprechend gekennzeichneten Teile - selbstständig verfasst und nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel - insbesondere keine im Quellenverzeichnis nicht benannten Internetquellen - benutzt hat, und die Arbeit vorher nicht in einem anderen Prüfungsverfahren eingereicht hat. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Passagen sind unter Angabe der Quellen kenntlich zu machen.
(12) Die Masterarbeit ist von der Betreuerin/dem Betreuer und einer weiteren Lehrperson aus dem Kreis der Prüfungsberechtigten nach § 28 schriftlich zu beurteilen. Die Bewertung der Masterarbeit soll von beiden Prüferinnen/Prüfern innerhalb von acht Wochen erfolgen; der Prüfungsausschuss kann Prüferinnen/Prüfern, die eine hohe Zahl von Masterarbeiten begutachten müssen, eine angemessen längere Frist einräumen.
(13) Die Benotung der Masterarbeit oder des von der einzelnen Kandidatin/einzelnen Kandidaten zu verantwortenden Teils der Gruppenarbeit ergibt sich aus dem arithmetischen Mittel der Bewertungen der Prüferinnen/Prüfer unter Berücksichtigung von § 15. Beträgt die Notendifferenz zwei volle Notenstufen oder mehr oder benotet eine Prüferin/ein Prüfer die Arbeit als nicht bestanden, bestellt der Prüfungsausschuss zur abschließenden Bewertung eine weitere Prüferin/einen weiteren Prüfer. Die Bewertung ergibt sich dann aus dem arithmetischen Mittel der beiden besten Bewertungen. Die Masterarbeit kann in diesem Fall nur als bestanden gelten, wenn mindestens zwei Prüfende die Arbeit mit „ausreichend“ oder besser bewerten. Nach abschließender Feststellung der Bewertung der Masterarbeit werden der Kandidatin/ dem Kandidaten das Gutachten und die Bewertungen zur Kenntnis gegeben.
(14) Wird die Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ bewertet, kann sie einmal wiederholt werden. Es muss ein neues Thema bearbeitet werden. Die Absätze 1 bis 13 gelten entsprechend. Der Antrag zur Wiederholung der Masterarbeit muss innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Benotung gestellt werden.
(1) Die angebotsspezifische Prüfungsordnung kann vorsehen, dass die Kandidatin/der Kandidat in einem Kolloquium zur Masterarbeit nachweisen muss, dass sie/er in einer Auseinandersetzung über den Themenbereich der Masterarbeit die erarbeiteten Lösungen selbstständig fachübergreifend und problembezogen auf wissenschaftlicher Grundlage vertreten kann. Die Zulassung zum Kolloquium setzt voraus, dass die Masterarbeit mindestens mit „ausreichend“ benotet ist. Das Kolloquium soll zum nächstmöglichen Termin, spätestens zwölf Wochen nach Abgabe der Masterarbeit, stattfinden.
(2) Das Kolloquium wird gemeinsam von den Prüferinnen/Prüfern der Masterarbeit als Einzelprüfung oder im Falle einer Gruppenarbeit als Gruppenprüfung durchgeführt. Die Dauer des Kolloquiums beträgt mindestens 20 und höchstens ca. 60 Minuten, sie ist bei einer Gruppenprüfung angemessen zu verlängern.
(3) Das Kolloquium wird unabhängig von der Masterarbeit benotet. Ist die Note des Kolloquiums nicht mindestens „ausreichend“, so wird auf Antrag der Kandidatin/des Kandidaten das Kolloquium einmal wiederholt. Wird binnen zwei Wochen kein Antrag gestellt oder wird das Kolloquium bei der Wiederholung nicht bestanden, so gilt die Masterarbeit als „nicht bestanden“. Bei einer Wiederholung der Masterarbeit gibt es auch für das Kolloquium zwei neue Prüfungsversuche.
(4) Aus der Note für die Masterarbeit und der Note für das Kolloquium wird unter Berücksichtigung von § 15 eine gemeinsame Note gebildet.
(1) Die Kandidatin/der Kandidat kann für Einzelprüfungen Prüferinnen/Prüfer vorschlagen, wenn die Prüfungsform dafür geeignet ist. Das Vorschlagsrecht kann im Rahmen der Veranstaltungsplanung in der Weise eingeschränkt werden, dass nur die lehrenden Dozentinnen/Dozenten die auf die Veranstaltungen folgende Prüfung abnehmen. Die Beisitzerin/Der Beisitzer soll im Einvernehmen mit der Kandidatin/dem Kandidaten bestellt werden. Der Prüfungsausschuss soll die Vorschläge berücksichtigen; sie begründen keinen Anspruch. Sofern die vorgeschlagene Prüferin/der vorgeschlagene Prüfer ablehnt, bestellt der Prüfungsausschuss unverzüglich eine andere Prüferin/einen anderen Prüfer.
(2) Mündliche Prüfungen werden von einer/einem Prüfenden und in der Regel von einer Beisitzerin/einem Beisitzer abgenommen; schriftliche Prüfungen werden von einer/einem Prüfenden bewertet. Eine Prüfung, die für die Kandidatin/den Kandidaten die letzte Wiederholungsmöglichkeit ist und von deren Bestehen die Fortsetzung des Studiums abhängt, müssen von zwei Prüfenden abgenommen bzw. bewertet werden.
(3) Prüfungen sind - mit Ausnahme von mündlichen Prüfungen - nicht öffentlich. Eine Vertreterin/Ein Vertreter des Rektors kann an Prüfungen als Beobachterin/ Beobachter teilnehmen. Auf Wunsch der Kandidatin/des Kandidaten kann die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden.
(1) Zur Teilnahme an einer Prüfungsleistung in einem Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodul ist eine Anmeldung beim zuständigen Prüfungsausschuss erforderlich. Die Zulassung zu einer Prüfung ist zu gewähren, wenn die Kandidatin/der Kandidat an der Universität Bremen oder einer Universität, mit der ein entsprechendes Kooperationsabkommen besteht, im betreffenden Weiterbildungsangebot eingeschrieben ist,
keine Prüfung in demselben oder einem verwandten Studiengang „endgültig nicht bestanden“ hat und
sich fristgerecht zu der jeweiligen Prüfung gemeldet hat und
das für das jeweilige Angebot festgesetzte Entgelt am Tag der Zulassung bezahlt hat.
(2) Die Anmeldefristen werden in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung geregelt.
(3) Der Rücktritt von einer Prüfung ist bis zu einem Monat vor dem Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen beim Prüfungsausschuss möglich.
(4) Im Falle des Nichterscheinens ohne gemäß § 16 Absatz 1 anerkannte Gründe gilt die Prüfung als abgelegt und nicht bestanden.
Im Prüfungsverfahren ist auf Art und Schwere einer Behinderung Rücksicht zu nehmen. Macht die Kandidatin/der Kandidat glaubhaft, dass sie/er wegen länger andauernder oder ständiger Krankheit oder Behinderung nicht in der Lage ist, Prüfungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann dies durch entsprechende Verlängerung der Arbeitszeit oder eine andere Gestaltung des Prüfungsverfahren ausgeglichen werden. Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden.
Die Inanspruchnahme der Schutzfristen entsprechend den §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes sowie entsprechend den Fristen des Gesetzes zum Erziehungsgeld und zur Elternzeit (Bundeserziehungsgeldgesetz - BerzGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Februar 2004 (BGBl. I S. 206) in der jeweils geltenden Fassung werden ermöglicht. Eine Ablegung von Prüfungen ist trotz Beurlaubung möglich. Wiederholungsprüfungen müssen nicht abgelegt werden.
(1) Die Bewertung der Prüfungsleistungen soll unverzüglich, in der Regel spätestens vier Wochen nach der Prüfung erfolgen. In Studiengängen mit großen Studierendenzahlen kann die angebotsspezifische Prüfungsordnung eine sechswöchige Bewertungszeit vorsehen. Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von der/vom jeweiligen Prüfenden festgesetzt. Für die Bewertung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:
| - | sehr gut, | eine sehr hervorragende Leistung |
| - | gut, | eine Leistung, die erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegt |
| - | befriedigend, | eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen entspricht |
| - | ausreichend, | eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anforderungen genügt |
| - | nicht ausreichend, | Eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel nicht mehr den Anforderungen genügt |
(2) Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistung können Zwischenwerte durch Erniedrigen oder Erhöhen der Noten um 0,3 gebildet werden; die Noten 4,3; 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen.
(3) Wird eine Modulprüfung als Kombinationsprüfung durchgeführt oder sind Teilprüfungen vorgesehen, wird aus den Prüfungsnoten der einzelnen Teilleistungen ein nach Leistungspunkten gewichteter arithmetischer Mittelwert errechnet. Die fachspezifische Prüfungsordnung kann eine andere Gewichtung vorsehen. Bei der Bewertung einer Prüfungsleistung durch mehrere Prüfende bildet sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten. Die Modulnote N ergibt sich aus dem berechneten Wert W gemäß
| W ≤ 1,15 : | N | = 1,0 |
| 1,15 < W ≤ 1,50 : | N | = 1,3 |
| 1,50 < W ≤ 1,85 : | N | = 1,7 |
| 1,85 < W ≤ 2,15 : | N | = 2,0 |
| 2,15 < W ≤ 2,50 : | N | = 2,3 |
| 2,50 < W ≤ 2,85 : | N | = 2,7 |
| 2,85 < W ≤ 3,15 : | N | = 3,0 |
| 3,15 < W ≤ 3,50 : | N | = 3,3 |
| 3,50 < W ≤ 3,85 : | N | = 3,7 |
| 3,85 < W ≤ 4,00 : | N | = 4,0 |
| 4,00 < W : | N | = 5,0 |
(4) Die Gesamtnote aller Prüfungen wird folgendermaßen ermittelt: Modulnoten, die Noten von Einzelprüfungen und die Note der Masterarbeit gehen in die Berechnung der Gesamtnote mit zwei Stellen nach dem Komma ein. Jede Note wird mit den zugehörigen CP multipliziert. Die Produkte werden addiert. Die Summe wird durch die Gesamtzahl der CP dividiert, die aufgrund benoteter Prüfungen erworben wurden. Nicht benotete Prüfungen werden nicht berücksichtigt. Gesamtnoten werden mit einer Stelle nach dem Komma ausgewiesen. Alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Angebotsspezifische Prüfungsordnungen können eine abweichende Regelung vorsehen.
(5) Die Gesamtnote einer bestandenen Masterprüfung lautet:
| bei einem Durchschnitt bis einschließlich | 1,5 | sehr gut, |
| bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich | 2,5 | gut, |
| bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich | 3,5 | befriedigend, |
| bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich | 4,0 | ausreichend. |
Bei überragenden Leistungen (Durchschnitt von 1,0 - 1,2) wird die Gesamtnote „Mit Auszeichnung bestanden“ erteilt. Bei der Berechnung werden die ersten beiden Dezimalstellen nach dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.
(6) Zusätzlich zu den Noten nach den Absätzen 3 - 5 werden ECTS-Grades für Modulprüfungen und für die Abschlussprüfung vergeben, sofern eine gesonderte Ordnung der Universität Bremen dies vorsieht.
| Grade A = | die besten 10% aller Studierenden, die die Prüfung erfolgreich bestanden haben |
| Grade B = | die nächsten 25%, |
| Grade C = | die nächsten 30%, |
| Grade D = | die nächsten 25%, |
| Grade E = | die nächsten 10%. |
(1) Eine Prüfung gilt als mit „nicht ausreichend“ bewertet, wenn die Kandidatin/der Kandidat einen für sie/ihn bindenden Prüfungstermin ohne triftigen Grund versäumt oder wenn sie/er eine Prüfung, zu der sie/er angetreten ist, ohne triftigen Grund abbricht. Dasselbe gilt, wenn eine schriftliche Prüfung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungszeit erbracht wird oder die Frist gemäß § 20 Absatz 1 überschritten wird.
(2) Der für das Versäumnis oder den Rücktritt geltend gemachte Grund muss der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin/des Kandidaten kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes, in Zweifelsfällen eines amtsärztlichen Attestes, verlangt werden. Der Krankheit der Kandidatin/des Kandidaten steht die Krankheit eines von ihr/ihm überwiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. Erkennt die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Gründe an, wird ein neuer Termin anberaumt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse sind in diesem Fall anzurechnen. Werden die Gründe nicht anerkannt, entscheidet unverzüglich der Prüfungsausschuss.
(1) Versucht eine Kandidatin/ein Kandidat, das Ergebnis einer Prüfung durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, fertigt die/der zuständige Prüfende oder die/der Aufsichtführende hierüber einen Vermerk an. Die Kandidatin/der Kandidat kann die Prüfung fortsetzen. Der Kandidatin/Dem Kandidaten ist Gelegenheit zur Stellungnahme über das Vorkommnis zu geben. Der Vermerk und die Stellungnahme sind unverzüglich dem Prüfungsausschuss zur Entscheidung vorzulegen. Stellt der Prüfungsausschuss einen Täuschungsversuch fest, gilt die Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet.
(2) Fehlerhafte oder unterlassene Angaben über benutzte Quellen (Plagiat) gelten als Täuschungsversuch, wenn Passagen, die veröffentlichten Arbeiten entnommen wurden, nicht als Zitat ausgewiesen sind.
(3) Eine Kandidatin/Ein Kandidat, die/der während einer Prüfung schuldhaft einen Ordnungsverstoß begeht, durch den andere Studierende oder die Prüfenden gestört werden, kann von den anwesenden Prüfenden oder den Aufsichtführenden von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden, wenn sie/er ihr/sein störendes Verhalten trotz Ermahnung fortsetzt. Über das Vorkommnis wird ein Vermerk angefertigt, der unverzüglich der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses vorgelegt wird. Vor Feststellung des Prüfungsausschusses, ob ein Ordnungsverstoß vorliegt, ist der Kandidatin/dem Kandidaten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Stellt der Prüfungsausschuss einen Ordnungsverstoß nach Satz 1 fest, wird die Prüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet. Andernfalls ist der Kandidatin/dem Kandidaten Gelegenheit zu geben, die Prüfungsleistung unverzüglich erneut zu erbringen.
(4) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der Kandidatin/dem Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen, zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.
(1) Ein Modul ist bestanden, wenn die Modulprüfung mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde. Umfasst die Modulprüfung eine Studienleistung, so setzt das Bestehen des Moduls die Bewertung der Studienleistung mit „bestanden“ voraus.
(2) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn alle jeweils geforderten Prüfungen bestanden und damit die geforderten Leistungspunkte erworben sind.
(3) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn
eine Modulprüfung nicht fristgemäß absolviert wird, es sei denn, die/der Studierende hat das Fristversäumnis nicht zu vertreten;
eine Modulprüfung bis zum Ablaufen der Frist zur Wiederholung von Prüfungen gemäß § 21 Absatz 1 mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet wurde oder als mit „nicht bestanden“ bewertet gilt.
(1) Ist eine Modulprüfung in einem Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodul nicht bestanden, so muss diese Modulprüfung innerhalb der Frist gemäß § 20 Absatz 1 wiederholt werden.
(2) Für die Dauer eines weiterbildenden Studiums und bis zu 12 Monaten nach seinem Ende können Modulprüfungen durch den Prüfungsausschuss angesetzt werden.
(3) Prüfungen im Pflicht- und im Wahlpflichtbereich müssen bestanden sein. Nicht bestandene Wahlmodule können bei Einhaltung der Frist gemäß § 20 Absatz 1 auch durch eine bestandene Prüfungsleistung in einem anderen Wahlmodul ersetzt werden.
(4) Die angebotsspezifische Prüfungsordnung kann für die erneute Prüfung eine andere Prüfungsform zulassen.
(5) An der Universität Bremen nicht bestandene Prüfungen können nur an der Universität Bremen wiederholt werden.
(6) Die Wiederholung ist auf die nicht bestandene Prüfungs- oder Studienleistung beschränkt. Bestandene Prüfungen können zur Notenverbesserung nicht wiederholt werden. Die im gleichen oder fachlich entsprechenden Studiengang an einer anderen wissenschaftlichen Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland erfolglos unternommenen Versuche, in einem Fach eine Prüfungsleistung abzulegen, werden auf die Fristen zur Ablegung von Wiederholungsprüfungen angerechnet. In Zweifelsfällen entscheidet der Prüfungsausschuss.
(7) Wird ein Wahlpflichtmodul aus organisatorischen Gründen nicht ein zweites Mal angeboten, so kann es durch ein anderes Wahlpflichtmodul ersetzt werden.
(1) Beim Nicht-Bestehen einer Prüfung kann die Prüfung zweimal wiederholt werden. Die Frist zur Beantragung der Wiederholungsprüfung beginnt mit der Woche, welche dem erstmaligen Ablegen der Prüfung folgt und endet nach sechs Wochen. Eine Wiederholung kann dabei auch bereits in der Woche, in dem die Prüfung erstmalig abgelegt wurde, stattfinden.
(2) Überschreiten Studierende die Frist nach Absatz 1, gelten die noch nicht erbrachten Modulprüfungen als abgelegt und nicht bestanden, sofern nicht triftige Gründe gem. § 16 Absatz 1 sowie der §§ 13 und 14 vorliegen.
(1) Prüfungsleistungen, die für das weiterbildende Angebot relevante Kompetenzen dokumentieren, werden von Amts wegen gemäß § 56 BremHG anerkannt und angerechnet, soweit keine wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der erlangten Kompetenzen eines Moduls im entsprechenden weiterbildenden Angebot an der Universität Bremen bestehen. Dabei wird kein schematischer Vergleich, sondern eine begründete Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorgenommen.
(2) Bei der Anrechnung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht wurden, sind die von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten. Im Rahmen von Hochschulkooperationen kann die Anerkennung von Modulen von Amts wegen in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung festgelegt werden.
(3) Absatz 1 gilt auch für Studienzeiten und Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten Hochschulen mit Fernstudiengängen und an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere im Rahmen von akkreditierten Studiengängen an staatlichen oder staatlich anerkannten Berufsakademien erbracht wurden, und für berufspraktische Tätigkeiten. Die Anerkennung von Sprachkenntnissen und berufspraktischen Tätigkeiten, die nicht bereits unter Absatz 1 fallen, kann in der angebotsspezifischen Prüfungsordnung geregelt werden.
(4) Werden Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen soweit die Notensysteme vergleichbar sind. Bei Notensystemen, deren Noten nicht in das System von § 15 übertragen werden können, wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen; es wird keine Gesamtnote gebildet. Eine Kennzeichnung der Anrechnung in der Bescheinigung erbrachter Prüfungsleistungen ist zulässig.
(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Studierenden haben die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen vorzulegen.
(6) Über die Anrechnung entscheidet der Prüfungsausschuss gegebenenfalls nach Anhörung von Fachvertreterinnen/Fachvertretern.
(7) Gegen ablehnende Entscheidungen kann die/der Studierende beim Prüfungsausschuss Widerspruch einlegen. Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab, ist er an den zuständigen Fachbereich weiterzuleiten. Das Dekanat entscheidet über den Widerspruch nach Anhörung der/des Studierenden, des Prüfungsausschusses und gegebenenfalls der zuständigen Fachvertreterin/des zuständigen Fachvertreters.
(1) Hat die Kandidatin/der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird die Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses oder Zertifikats bekannt, so kann die Note der Prüfung berichtigt werden. Gegebenenfalls kann die Prüfung für „nicht ausreichend“ und die Prüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin/der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses oder Zertifikates bekannt, so wird der Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die Kandidatin/der Kandidat vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass sie/er die Prüfung ablegen konnte, so kann die Prüfung für „nicht ausreichend“ und z. B. die Masterprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.
(3) Der Kandidatin/Dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.
(4) Das unrichtige Zeugnis oder Zertifikat ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu erteilen. Mit dem unrichtigen Zeugnis ist auch die Masterurkunde einzuziehen, wenn eine Masterprüfung aufgrund einer Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.
(1) Wenn eine Studentin/ein Student die Weiterbildung durch schriftlich erfolgte Kündigung endgültig aufgibt, wird ihr/ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise eine Bescheinigung über ihre/seine Studienleistungen und Prüfungen ausgestellt.
(2) Werden Prüfungsentscheidungen mit dem Rechtsbehelf des Widerspruchs angefochten, entscheidet, soweit der Prüfungsausschuss diesem nicht abhilft, der zentrale Widerspruchsausschuss der Universität Bremen; der Widerspruch ist dem Widerspruchsausschuss unverzüglich zuzuleiten.
(3) Der Widerspruchsausschuss wird vom Akademischen Senat gewählt. Er besteht aus drei Hochschullehrerinnen/Hochschullehrern, einer Akademischen Mitarbeiterin/einem Akademischen Mitarbeiter und einer/einem Studierenden. Die Amtszeit der/des Studierenden beträgt ein Jahr, die der anderen Mitglieder zwei Jahre.
(4) Der Widerspruchsausschuss entscheidet nach Anhörung der/des Beteiligten über einen Widerspruch. Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden.
(5) Der Prüfungsausschuss macht Anordnungen, Festsetzungen von Terminen und Fristen sowie andere Mitteilungen des Prüfungsausschusses mit rechtsverbindlicher Wirkung auf geeignete Weise bekannt.
(6) Der Kandidatin/Dem Kandidaten muss in schriftliche Prüfungsarbeiten nach der Bewertung umgehend Einsicht ermöglicht werden.
(7) Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Studiums wird der Kandidatin/dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in die Prüfungsprotokolle der Masterarbeit und ggf. des Kolloquiums gewährt.
(8) Ist die Masterarbeit endgültig nicht bestanden, stellt die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses einen Bescheid mit Angaben aller Prüfungsleistungen und den Gründen für das Nicht-Bestehen der Masterprüfung aus. Der Bescheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und der oder dem Studierenden bekannt zu geben.
(1) Über die bestandene Masterprüfung soll unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen nach Bestehen der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis (vgl. Anlage 1) ausgestellt werden. Das Zeugnis enthält die Gesamtnote und das Thema der Masterarbeit. Die Studienschwerpunkte werden in geeigneter Form zusammengefasst ausgewiesen. Freiwillige Zusatzleistungen sind nicht Bestandteil des Zeugnisses. Die Notenbildung erfolgt gemäß § 15 Absatz 3. Das Zeugnis weist die Fachrichtung aus. Das Zeugnis ist von der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel der Universität Bremen zu versehen. Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht und bewertet worden ist.
(2) Zusätzlich erbrachte Prüfungsleistungen können als Zusatzleistungen in der Bescheinigung erbrachter Prüfungsleistungen ausgewiesen werden. Benotete Zusatzleistungen fließen nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein.
(3) In der Urkunde (vgl. Anlage 1) wird die Verleihung des Mastergrades bekundet. Die Urkunde wird durch die Dekanin/den Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel der Universität Bremen versehen.
(4) Außerdem erhält die/der Studierende ein englischsprachiges Diploma Supplement (vgl. Anlage 2) und eine Bescheinigung erbrachter Prüfungsleistungen (vgl. Anlage 3) mit dem Datum des Zeugnisses ausgehändigt. In der Bescheinigung erbrachter Prüfungsleistungen werden alle bestandenen Modulprüfungen einschließlich der dafür vergebenen Leistungspunkte und Prüfungsnoten aufgenommen (Leistungsübersicht). Es werden nur vollständige Module (keine Teilprüfungen oder einzelne Lehrveranstaltungen) ausgewiesen. Das Diploma Supplement wird von der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet. Zusatzleistungen werden auf Antrag der/des Studierenden in der Bescheinigung erbrachter Prüfungsleistungen ausgewiesen. Sie können auf Antrag des/der Studierenden auch ohne Note ausgewiesen werden.
(5) Urkunde und Zeugnis werden in deutscher und englischer Sprache erstellt. Das Diploma Supplement wird in englischer Sprache erstellt. Die Bescheinigung erbrachter Prüfungsleistungen wird in deutscher Sprache erstellt. Auf Antrag der/des Studierenden wird der Bescheinigung erbrachter Prüfungsleistungen zusätzlich eine englischsprachige Übersetzung beigefügt. Bei einem englischsprachigen Studiengang werden die jeweiligen Dokumente nur in Englisch ausgestellt.
(6) Für die Mastergrade sind folgende Bezeichnungen ohne weitere Zusätze zu verwenden:
| Fach | Gradbezeichnung |
| Sprach- und Kulturwissenschaften Sport, Sportwissenschaft, Sozialwissenschaft Kunstwissenschaft Fachbezogene Bildungswissenschaften | Master of Arts (M. A.) |
| Human- und Gesundheitswissenschaft | Master of Arts (M. A) oder Master of Science (M. Sc.) |
| Mathematik, Naturwissenschaften Ernährungswissenschaften | Master of Science (M. Sc.) |
| Ingenieurwissenschaften | Master of Science (M. Sc.) oder Master of Engineering (M. Eng.) |
| Wirtschaftswissenschaften |
Master of Arts (M. A.) oder Master of Science (M. Sc.) |
| Rechtswissenschaften | Master of Laws (LL. M.) |
| Lehrerbildende Studiengänge | Master of Education (M. Ed.) |
Bei interdisziplinären Studiengängen richtet sich die Abschlussbezeichnung nach demjenigen Fachgebiet, dessen Bedeutung im Studiengang überwiegt; bei den Ingenieurwissenschaften und den Wirtschaftswissenschaften richtet sie sich nach der inhaltlichen Ausrichtung des Studiengangs.
(1) Über die erfolgreich abgeschlossene Weiterbildung soll unverzüglich, möglichst innerhalb von vier Wochen nach Bestehen der letzten Studien- oder Prüfungsleistung, ein Zertifikat ausgestellt werden. Die Studienschwerpunkte und -inhalte werden in geeigneter Form zusammengefasst ausgewiesen. Die Notenbildung erfolgt gemäß § 15 Absatz 3. Das Zertifikat ist von der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen und mit dem Siegel der Universität Bremen zu versehen. Das Zertifikat trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Studien- oder Prüfungsleistung erbracht worden ist.
(2) Zusätzlich erbrachte Prüfungsleistungen können als Zusatzmodule bzw. -veranstaltungen in der Bescheinigung erbrachter Prüfungsleistungen ausgewiesen werden. Benotete Zusatzmodule/ -veranstaltungen fließen nicht in die Berechnung der Gesamtnote ein.
(3) Das Zertifikat wird in deutscher Sprache erstellt. Weitere Details regelt die angebotsspezifische Prüfungsordnung.
(1) Im Modulstudium nach § 2 Absatz 5 wird die Bescheinigung über die bestandene Modulprüfung erworben, die u. a. die erworbenen Leistungspunkte ausweist.
(2) Gasthörer nehmen nicht am Modulstudium teil und erhalten deshalb keine Bescheinigungen.
(1) Die Fachbereiche bilden einen oder mehrere Prüfungsausschüsse, die auch für die weiterbildenden Studienangebote des Fachbereichs zuständig sind. Für fächerübergreifende Studienprogramme können mehrere Fachbereiche einen gemeinsamen Prüfungsausschuss bilden. Das Recht zur Bildung eines gemeinsamen Prüfungsausschusses kann auch auf einen Gemeinsam Beschließenden Ausschuss übertragen werden. Die Aufgaben für die weiterbildenden Studienangebote können auch den bereits bestehenden Prüfungsausschüssen übertragen werden. Für das „Modulstudium“ bedarf es keiner Befassung in einem Prüfungsausschuss.
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus:
drei Mitgliedern des Fachbereichs, die Hochschullehrerinnen/Hochschullehrer sind,
einem Mitglied der akademischen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Fachbereichs,
einer/einem Studierenden des Fachbereichs, dem der Studiengang zugeordnet ist.
(3) Der Fachbereichsrat bzw. der Gemeinsam Beschließende Ausschuss kann die Zahl der Mitglieder erhöhen, wenn die Zahl der Studiengänge dies erfordert. Dabei müssen die Mitglieder nach Absatz 2 Nummer 1 die Mehrheit bilden.
(4) Die Mitglieder nach Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 2 und ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter werden für die Dauer von zwei Jahren, die Mitglieder nach Absatz 2 Nummer 3 und ihre Stellvertreterinnen/Stellvertreter für die Dauer von einem Jahr durch die jeweiligen Vertreterinnen/Vertreter ihrer Gruppe im zuständigen Fachbereichsrat gewählt. Die Mitgliedschaft beginnt am Tag der ersten Sitzung des Prüfungsausschusses nach den Wahlen. Die Wiederwahl ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine Nachfolgerin/ein Nachfolger für die restliche Amtszeit gewählt.
(5) Der Prüfungsausschuss wählt je ein Mitglied nach Absatz 2 Nummer 1 zur/zum Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden. Die/Der Vorsitzende führt die laufenden Geschäfte des Prüfungsausschusses; sie/er wird hierbei von der/dem stellvertretenden Vorsitzenden unterstützt. Der Prüfungsausschuss kann der/dem Vorsitzenden und der/dem stellvertretenden Vorsitzenden Zuständigkeiten zur alleinigen Entscheidung übertragen. Dem Prüfungsausschuss ist regelmäßig über die getroffenen Entscheidungen zu berichten. Betroffene Studierende können gegen Entscheidungen der/des Vorsitzenden beim Prüfungsausschuss Widerspruch einlegen. Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung.
(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder, darunter die/der Vorsitzende oder die/der stellvertretende Vorsitzende, anwesend sind. Beschlüsse bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen; bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden, bei deren/dessen Abwesenheit die Stimme der/des stellvertretenden Vorsitzenden. Bei Beschlussunfähigkeit wird der Prüfungsausschuss erneut zur Verhandlung über denselben Gegenstand einberufen; er ist dann bei Anwesenheit der/des Vorsitzenden oder der/des stellvertretenden Vorsitzenden ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn darauf in der Einladung hingewiesen worden ist. Stellt die/der Vorsitzende oder im Verhinderungsfall die/der stellvertretende Vorsitzende fest, dass eine Angelegenheit, die in die Zuständigkeit des Prüfungsausschusses fällt, keinen Aufschub bis zur nächstmöglichen Sitzung duldet, entscheidet sie/er selbst. Der Prüfungsausschuss muss in seiner nächsten Sitzung über die Entscheidung unterrichtet werden.
(7) Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind Protokolle zu fertigen. Jedes Protokoll muss Angaben enthalten über den Ort und Tag der Sitzung, die Namen der/des Vorsitzenden und der anwesenden Ausschussmitglieder, den behandelten Gegenstand, die gestellten Anträge und die gefassten Beschlüsse. Das Protokoll ist von der/dem Vorsitzenden zu unterzeichnen.
(8) Der Prüfungsausschuss ist für die Organisation der Prüfungen und alle damit im Zusammenhang stehenden Aufgaben verantwortlich. Er beschließt abschließend über
die Folgen von Verstößen gegen die Prüfungsvorschriften,
Bestehen und Nicht-Bestehen der Master- oder Zertifikatsprüfung,
die Anrechnung von Prüfungs- und Studienleistungen,
die Festsetzung von Anmeldeterminen für Prüfungen,
die Bestellung von Prüferinnen/Prüfern, Beisitzerinnen/Beisitzern und Gutachterinnen/Gutachtern,
die Ausgabe und Verlängerung der Bearbeitungszeit der Masterarbeit oder sonstigen
Abschlussarbeit,
die Ausgabe von Zeugnissen, Zertifikaten, Urkunden und Diploma Supplements,
die Ausgabe von Bescheiden.
(9) Der Prüfungsausschuss des jeweiligen Weiterbildungsangebots entscheidet über alle im Studium angebotenen Module.
(10) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Abnahme der Prüfungen sowie der Beratung und der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse beizuwohnen.
(11) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Prüfungsordnung eingehalten werden.
(12) Der Prüfungsausschuss kann der Akademie für Weiterbildung oder dem Prüfungsamt Aufgaben gemäß Absatz 8 übertragen, soweit sich die Entscheidungen unzweifelhaft aus den vorliegenden Daten und Unterlagen ergeben. In Zweifelsfällen und über die Abhilfe der Widersprüche entscheidet der Prüfungsausschuss.
(13) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellvertreterinnen/Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende/den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.
Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer werden gemäß § 62 Absatz 3 des Bremischen Hochschulgesetzes vom Prüfungsausschuss bestellt. Beisitzerinnen/Beisitzer führen das Protokoll und wirken beratend an der Bewertung der Prüfungsleistung mit.
(1) Diese Ordnung tritt mit der Genehmigung durch den Rektor in Kraft.
(2) Bestehende befristete Weiterbildungsordnungen bleiben bis Fristende in Kraft.
(3) Studierende beenden ihr weiterbildendes Studium nach der Ordnung, unter der sie das Studium aufgenommen haben. Dies gilt bis maximal zwei Jahre nach Fristende lt. Absatz 2.
(4) Angebote der wissenschaftlichen Weiterbildung sind entgeltpflichtig.
(5) Im Übrigen gelten die Teilnahmebedingungen der Akademie für Weiterbildung (AGB) in der jeweils gültigen Fassung.
Genehmigt, Bremen, den 23. Oktober 2013
Der Rektor
der Universität Bremen
Diploma Supplement
Diploma Supplement
HOLDER OF THE QUALIFICATION
Family Name / 1.2 First Name
Date, Place, Country of Birth
Student ID Number or Code
QUALIFICATION
Name of Qualification (full, abbreviated; in original language)
Main Field(s) of Study
Institution Awarding the Qualification (in original language)
University of Bremen
Status (Type / Control)
State University / College
Institution Administering Studies (in original language)
cf. item, 2.3.
Status (Type / Control)
cf. item, 2.3.
Language(s) of Instruction/Examination
German
LEVEL OF THE QUALIFICATION
Level
Accredited on
Accredited by
Accredited of
Official Length of Programme
x semesters of studies / xxx credit points in ECTS
Access Requirements
CONTENTS AND RESULTS GAINED
Mode of Study
Programme Requirements/Qualification Profile of the Graduate
Aim of Studies
Compulsory and Elective Areas
Programme Content /Specialisations
Key Qualifications
Other
Programme Details
Grading Scheme
cf. item, 8.6.
Overall Classification (in original language)
The overall assessment is entered on the Examination Certificate.
FUNCTION OF THE QUALIFICATION
Access to Further Study
Professional Status
ADDITIONAL INFORMATION
Additional Information
./.
Further Information Sources
Institution: www.uni-bremen.de
For additional information on the German system of higher education see section 8.
CERTIFICATION
This Diploma Supplement refers to the following original documents:
Degree Certificate dd.
Examination Certificate dd.
Chairman Examination Committee
| Bremen, | (Official Stamp/Seal) | Prof. Dr. |
INFORMATION ON THE GERMAN HIGHER EDUCATION SYSTEM1
Types of Institutions and Institutional Status
Higher education (HE) studies in Germany are offered at three types of Higher Education Institutions (HEI)2
- Universitäten (Universities) including various specialized institutions, offer the whole range of academic disciplines. In the German tradition, universities focus in particular on basic research so that advanced stages of study have mainly theoretical orientation and research-oriented components.
- Fachhochschulen (Universities of Applied Sciences) concentrate their study programmes in engineering and other technical disciplines, business-related studies, social work, and design areas. The common mission of applied research and development implies a distinct application-oriented focus and professional character of studies, which include integrated and supervised work assignments in industry, enterprises or other relevant institutions.
- Kunst- und Musikhochschulen (Universities of Art/Music) offer studies for artistic careers in fine arts, performing arts and music; in such fields as directing, production, writing in theatre, film, and other media; and in a variety of design areas, architecture, media and communication.
Higher Education Institutions are either state or state-recognized institutions. In their operations, including the organization of studies and the designation and award of degrees, they are both subject to higher education legislation.
Types of Programmes and Degrees Awarded
Studies in all three types of institutions have traditionally been offered in integrated „long“ (one-tier) programmes leading to Diplom- or Magister Artium degrees or completed by a Staatsprüfung (State Examination).
Within the framework of the Bologna-Process one-tier study programmes are successively being replaced by a two-tier study system. Since 1998, a scheme of first- and second-level degree programmes (Bachelor and Master) was introduced to be offered parallel to or instead of integrated „long“ programmes. These programmes are designed to provide enlarged variety and flexibility to students in planning and pursuing educational objectives, they also enhance international compatibility of studies.
The German Qualification Framework for Higher Education Degrees3 describes the degrees of the German Higher Education System. It contains the classification of the qualification levels as well as the resulting qualifications and competencies of the graduates.
For details cf. Sec. 8.4.1, 8.4.2, and 8.4.3 respectively. Table 1 provides a synoptic summary.
Approval/Accreditation of Programmes and Degrees
To ensure quality and comparability of qualifications, the organization of studies and general degree requirements have to conform to principles and regulations established by the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany (KMK)4 In 1999, a system of accreditation for programmes of study has become operational under the control of an Accreditation Council at national level. All new programmes have to be accredited under this scheme; after a successful accreditation they receive the quality-label of the Accreditation Council5
Table 1: Institutions, Progammes and Degrees in German Higher Education
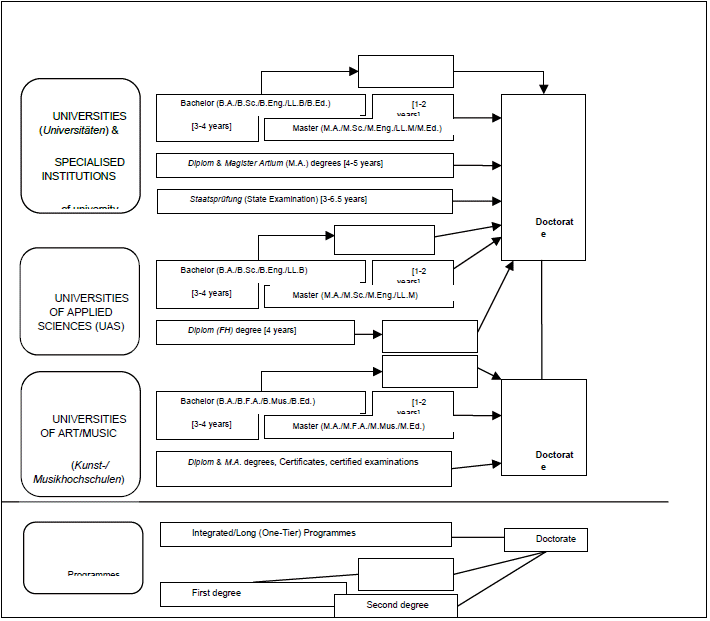
Organization and Structure of Studies
The following programmes apply to all three types of institutions. Bachelor’s and Master’s study courses may be studied consecutively, at various higher education institutions, at different types of higher education institutions and with phases of professional work between the first and the second qualification. The organization of the study programmes makes use of modular components and of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) with 30 credits corresponding to one semester.
Bachelor
Bachelor degree study programmes lay the academic foundations, provide methodological skills and lead to qualifications related to the professional field. The Bachelor degree is awarded after 3 to 4 years.
The Bachelor degree programme includes a thesis requirement. Study courses leading to the Bachelor degree must be accredited according to the Law establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany6
First degree programmes (Bachelor) lead to Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), Bachelor of Music (B.Mus.) or Bachelor of Education (B.Ed.).
Master
Master is the second degree after another 1 to 2 years. Master study programmes must be differentiated by the profile types „more practice-oriented“ and „more research-oriented“. Higher Education Institutions define the profile of each Master study programme.
The Master degree study programme includes a thesis requirement. Study programmes leading to the Master degree must be accredited according to the Law establishing a Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany7 Second degree programmes (Master) lead to Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master of Engineering (M.Eng.), Master of Laws (L.L.M), Master of Fine Arts (M.F.A.), Master of Music (M.Mus.) or Master of Education (M.Ed.). Master study programmes, which are designed for continuing education or which do not build on the preceding Bachelor study programmes in terms of their content, may carry other designations (e.g. MBA).
Integrated „Long“ Programmes (One-Tier):
Diplom degrees, Magister Artium, Staatsprüfung
An integrated study programme is either mono-disciplinary (Diplom degrees, most programmes completed by a Staatsprüfung) or comprises a combination of either two major or one major and two minor fields (Magister Artium). The first stage (1.5 to 2 years) focuses on broad orientations and foundations of the field(s) of study.
An Intermediate Examination (Diplom-Vorprüfung for Diplom degrees; Zwischenprüfung or credit requirements for the Magister Artium) is prerequisite to enter the second stage of advanced studies and specializations. Degree requirements include submission of a thesis (up to 6 months duration) and comprehensive final written and oral examinations. Similar regulations apply to studies leading to a Staatsprüfung. The level of qualification is equivalent to the Master level.
- Integrated studies at Universitäten (U) last 4 to 5 years (Diplom degree, Magister Artium) or 3 to 6.5 years (Staatsprüfung). The Diplom degree is awarded in engineering disciplines, the natural sciences as well as economics and business. In the humanities, the corresponding degree is usually the Magister Artium (M.A.). In the social sciences, the practice varies as a matter of institutional traditions. Studies preparing for the legal, medical, pharmaceutical and teaching professions are completed by a Staatsprüfung.
The three qualifications (Diplom, Magister Artium and Staatsprüfung) are academically equivalent. They qualify to apply for admission to doctoral studies. Further prerequisites for admission may be defined by the Higher Education Institution, cf. Sec. 8.5.
- Integrated studies at Fachhochschulen (FH)/Universities of Applied Sciences (UAS) last 4 years and lead to a Diplom (FH) degree. While the FH/UAS are non-doctorate granting institutions, qualified graduates may apply for admission to doctoral studies at doctorate-granting institutions, cf. Sec. 8.5.
- Studies at Kunst- and Musikhochschulen (Universities of Art/Music etc.) are more diverse in their organization, depending on the field and individual objectives. In addition to Diplom/Magister degrees, the integrated study programme awards include Certificates and certified examinations for specialized areas and professional purposes.
Doctorate
Universities as well as specialized institutions of university standing and some Universities of Art/Music are doctorate-granting institutions. Formal prerequisite for admission to doctoral work is a qualified Master (UAS and U), a Magister degree, a Diplom, a Staatsprüfung, or a foreign equivalent. Particularly qualified holders of a Bachelor or a Diplom (FH) degree may also be admitted to doctoral studies without acquisition of a further degree by means of a procedure to determine their aptitude. The universities respectively the doctorate-granting institutions regulate entry to a doctorate as well as the structure of the procedure to determine aptitude. Admission further requires the acceptance of the Dissertation research project by a professor as a supervisor.
Grading Scheme
The grading scheme in Germany usually comprises five levels (with numerical equivalents; intermediate grades may be given): „Sehr Gut“ (1) = Very Good; „Gut“ (2) = Good; „Befriedigend“ (3) = Satisfactory; „Ausreichend“ (4) = Sufficient; „Nicht ausreichend“ (5) = Non-Sufficient/Fail. The minimum passing grade is „Ausreichend“ (4). Verbal designations of grades may vary in some cases and for doctoral degrees. In addition institutions may already use the ECTS grading scheme, which operates with the levels A (best 10 %), B (next 25 %), C (next 30 %), D (next 25 %), and E (next 10 %).
Access to Higher Education
The General Higher Education Entrance Qualification (Allgemeine Hochschulreife, Abitur) after 12 to 13 years of schooling allows for admission to all higher educational studies. Specialized variants (Fachgebundende Hochschulreife) allow for admission to particular disciplines. Access to Fachhochschulen (UAS) is also possible with a Fachhochschulreife, which can usually be acquired after 12 years of schooling. Admission to Universities of Art/Music may be based on other or require additional evidence demonstrating individual aptitude. Higher Education Institutions may in certain cases apply additional admission procedures.
National Sources of Information
Kultusministerkonferenz (KMK) [Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany]; Lennestrasse 6, D-53113 Bonn; Fax: +49[0]228/501- 229; Phone: +49[0]228/501-0 - Central Office for Foreign Education (ZaB) as German NARIC; www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org
„Documentation and Educational Information Service“ as German EURYDICE-Unit, providing the national dossier on the education system (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail: eurydice@kmk.org)
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) [German Rectors’ Conference]; Ahrstrasse 39, D-53175 Bonn; Fax: +49[0]228/887-110; Phone: +49[0]228/887-0; www.hrk.de;
E-Mail: sekr@hrk.de
„Higher Education Compass“ of the German Rectors’ Conference features comprehensive information on institutions, programmes of study, etc. (www.higher-education-compass.de)
The information covers only aspects directly relevant to purposes of the Diploma Suplement. All information as of 1 December 2008.
Berufsakademien are not considered as Higher Education Institutions, they only in some oft he Länder. They ofer educational programmes in close cooperation with private companies. Students receive a formal degree and carry out an apprenticeship at the company. Some Berufsakademien offer Bachelor courses which are recognized as an academic degree if they are accredited by a German accreditation agency.
German Qualification Framework for Higher Education Degrees (Resolution oft he Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs oft he Länder in the Federal Republic of Germany.
Common structural guidelines oft he Länder as set out in Article 9 Clause 2 of the Framework Act for Higher Education (HRG) for the accreditation of Bachelor’s and Master’s study courses (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 10.10.2003, as amended on 21.04.2005).
„Law establishing a Foundation ,Foundation fort he Accreditation of Study Programmes in Germany‘“, entered into force as from 26.02.2005, GV. NRW. 2005, nr. 5, p. 45 in connection with the Declaration of the Länder to the Foundation „Foundation: Foundation for the Accreditation of Study Programmes in Germany“ (Resolution of the Standing Conference of the Ministers of Education and Cultural Affairs of the Länder in the Federal Republic of Germany of 16.12.2004.
See note No. 5.
See note No. 5.